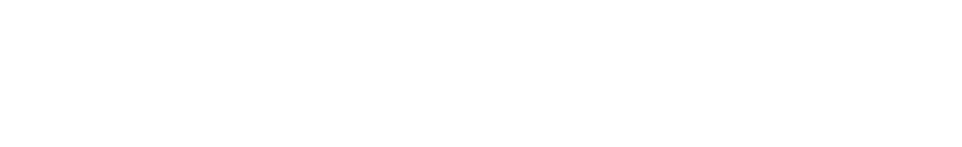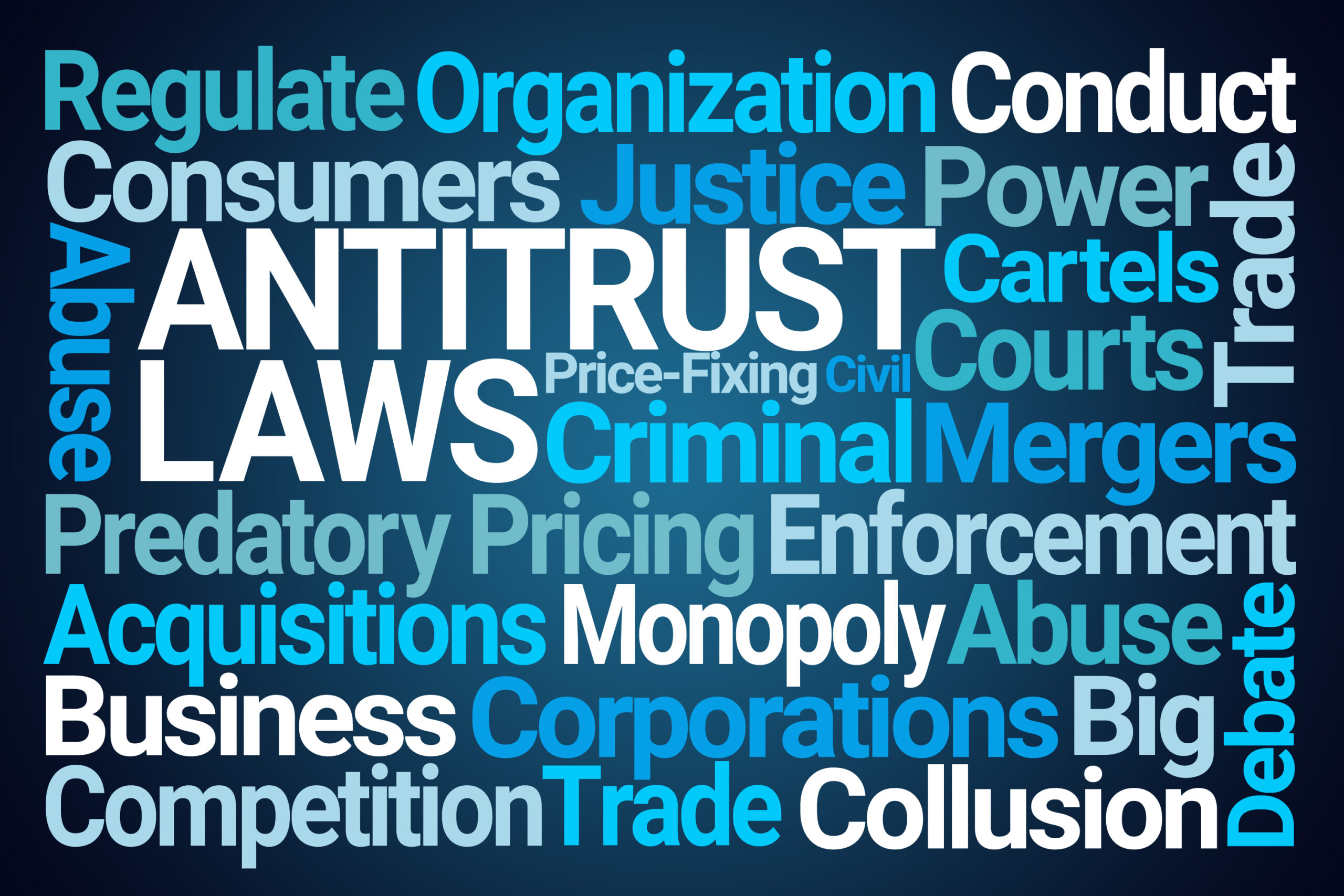
© Rob Wilson / shutterstock.com
Der Onlinehandel ist geprägt von schneller Veränderung und wachsendem Wettbewerb. In diesem sich ständig wandelndem Geschäft sind effektive und effiziente Lösungen elementar wichtig. KI ist dabei ein entscheidender Faktor für die Zukunft, da die traditionellen Grenzen des Onlinehandels durch den gezielten Einsatz von KI verschoben werden und Optimierungspotentiale viel besser umgesetzt werden können.
Der Einsatz von KI führt für Onlinehändler auch kartellrechtlich zu neuen Themenkreisen, was sowohl zu Rechtsansprüchen führen kann als auch Compliancerisiken mit sich bringen kann.
Compliancerisiken für Onlinehändler
KI und insbesondere Algorithmen können von konkurrierenden Onlinehändlern als „Gehilfe“ einer Preisabsprache oder sonstigen kartellrechtswidrigen Hardcoreabsprache (beispielsweise Kundenaufteilung oder Gebietsaufteilung) eingesetzt werden. In diesem Kontext kann etwa entsprechende Software strategische Informationen zwischen den Onlinehändlern übermitteln oder diese Informationen analysieren. Auch die Implementierung von kartellrechtswidrigen Absprachen kann über KI erfolgen. Teilweise spielt dies auch für vertikale Preisbindungen von Herstellern gegenüber Onlinehändlern eine Rolle, wenn durch Algorithmen Abweichungen von vorgegebenen Wiederverkaufspreisen kontrolliert werden. Eine Zurechnung des kartellrechtswidrigen Verhaltens gegenüber dem verstoßenden Unternehmen ist in diesen Fällen in der Regel möglich.
Beispiel: Ein Online-Reisebuchungssystem ermöglicht es Reisebüros. Reisen über die eigene Website in einer einheitlichen vom Online-Reisebuchungssystem festgelegten Buchungsform anzubieten. Der Anbieter des Online-Reisebuchungssystems fordert die Kunden (Reisebüros) dazu auf, den Rabatt bei Onlinebuchungen auf maximal 3% festzusetzen.
Schwieriger ist die Zurechnung des kartellrechtswidrigen Verhaltens, wenn es um dem Einsatz selbstlernender Algorithmen oder „algorithmische Kommunikation“ geht.
Beispiel: Selbstlernende Algorithmen von verschiedenen Händlern zeigen sich automatisch gegenseitig in Form von Signalen an, wenn sie den Preis ändern möchten.
Es gibt die Tendenz, dass eine Zurechnung schon durch den bloßen (fortdauernden) Einsatz von KI erfolgen kann, so dass ein mit sehr hohen Bußgeldern bewehrter Kartellrechtsverstoß vorliegen kann. Bei dem Einsatz von KI müssen Onlinehändler diese Risiken deshalb im Einzelfall sorgfältig vorab prüfen.
Rechtsansprüche für Onlinehändler
Es gibt aber auch Ansprüche, die Onlinehändler aus Kartellrechtsverstößen infolge des Einsatzes von künstlicher Intelligenz herleiten können.
Beispiel: Ein Herstellern kontrolliert die Befolgung von grundsätzlich legitimen Preisempfehlungen ein Monitoring, welches auf Basis von KI funktioniert
Auch ist es denkbar, dass Lieferanten sich mit Wettbewerbern mittels KI Preissignale zuspielen, was für Onlinehändler zu erhöhten Preisen führen kann.
Auch Marktmacht kann eine Rolle spielen. Die Europäische Kommission prüft intensiv Vereinbarungen zwischen großen digitalen Marktteilnehmern und Entwicklern und Anbietern von sog. generativer KI auf Wettbewerbsbeschränkungen.
Der Zugang zu KI-Technologie kann im Einzelfall so wichtig für ein Unternehmen für den Markteintritt von Anwendungsentwicklern sein, dass ein Unternehmen als Inhaber der Technologie den Zugang zu der Technologie gewähren muss.
Nicht alle Konstellation können durch den Digital Markets Act (DMA) und das neue deutsche Kartellrecht zur Begrenzung der Marktmacht von sog. gatekeepern (§ 19 a GWB) erfasst werden.
Der DMA setzt für die Anwendbarkeit das Vorliegen eines zentralen Plaffformdienstes voraus. KI fällt aktuell nicht allgemein darunter. Insofern ist der DMA nur einschlägig, wenn der zentrale Plattformdienst mit KI kombiniert wird. Das ist aber durchaus von Relevanz, da sich insbesondere datengetriebene Netzwerkeffekte verstärken können. KI eröffnet neue Möglichkeiten Daten zu verarbeiten und verknüpft diese auf neue Weise. Die Marktmacht der großen Player kann damit zunehmen.
§ 19 a GWB, der gegen Mißbrauch durch sog. superdominante Unternehmen schützt, kann grundsätzlich auf große Anbieter künstlicher Intelligenz anwendbar sein, sofern das KI-Produkt überragende marktübergreifende Bedeutung hat.
Darüber hinaus findet das allgemeine kartellrechtliche Mißbrauchsrecht Anwendung.
Wenn KI Anbieter absolut marktbeherrschend sind oder auch, wenn sie nur gegenüber bestimmten Kunden eine sog. relative Marktmacht haben, können sich Ansprüche von Onlinehändlern auf Zugang, Belieferung und Gleichbehandlung mit Wettbewerbern ergeben.
Für Onlinehändler können durch KI neue Abhängigkeiten entstehen und es bilden sich möglicherweise neue unverzichtbare Instrumente und sog. bottlenecks durch die alle schlüpfen müssen. In diesen Fällen können Ansprüche für Onlinehändler sehr wichtig werden.
DMA-Verstöße sowie auch Verstöße gegen § 19 a GWB und allgemeine kartellrechtliche Mißbrauchsverbot können zivilrechtlich geltend gemacht werden und zu Unterlassungs-, Zugangs-, Liefer- und Schadensersatzansprüchen für Onlinehändler führen.
Fazit
Die zunehmende Bedeutung von KI hat aus Compliance-Sicht als auch unter dem Aspekt von kartellrechtlichen Ansprüchen von Onlinehändlern hohe Relevanz.
Ihr Ansprechpartner
Rechtsanwalt Dr. Nils Ellenrieder, LL.M. (Edinburgh)
kontakt@ellenrieder-kartellrecht.com